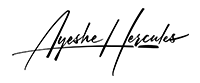Wie viel Körperfett ist normal?
Zu wenig Körperfett ist ein gesundheitliches Risiko. Zuviel Körperfett ist ein gesundheitliches Risiko. Wie viel Körperfett ist normal und wie viel Körperfett ist optimal?
Körperfett ist trotz allgemeiner Unbeliebtheit ein eigenes Organ und hat sogar verschiedenen Funktionen.
Es schützt Organe und Gelenke, reguliert unsere Körpertemperatur, speichert Vitamine und dient als Energiereserve. Um seine Funktion besser zu verstehen, kann man es in zwei Arten unterteilen: essentielles und nicht essentielles Körperfett.
Essentielles Körperfett (braunes Fettgewebe) braucht unser Körper, um zu funktionieren. Es wird in Knochen, Organen, im zentralen Nervensystem und in den Muskeln gelagert. Diese Art von Fett hilft dem Körper bei der Temperaturregulierung, dient als Polster für die inneren Organe und liefert dem Körper Energie, wenn wir krank sind. Braunes Fett hat einen positiven Einfluss auf die Gesundheit von Herz und Stoffwechsel. Das wollen wir behalten oder sogar vermehren.
Als nicht-essentielles oder überflüssiges Körperfett wird das weiße Depotfett bezeichnet, von dem wir lieber weniger als mehr haben wollen.
Denn weiße Fettzellen produzieren mehr als 600 verschiedene Hormone und Botenstoffe, die vom Körperfett ins Blut abgegeben werden. Über 20 davon stehen in direktem Zusammenhang mit Asthma, Herz-Kreislauf-Krankheiten wie Schlaganfall und Herzinfarkt, Gicht, Gallenprobleme, Embolien und sogar Depressionen.
Zu viel weißes Fettgewebe begünstigt Bluthochdruck, Diabetes, Gefäßverkalkung, Organschäden und sogar die Entstehung von Krebszellen. Die Weltgesundheitsorganisation hat bestätigt, dass Übergewicht der Auslöser für eine halbe Million der jährlichen Krebsneuerkrankungen ist. Krebsspezialisten in Harvard schätzen sogar, dass zu viel Körperfett weltweit bald führende Ursache für Krebserkrankungen sein wird, noch vor dem Rauchen [1] .
Bezogen auf die Gesundheit ist nicht das Körpergewicht entscheidend, sondern tatsächlich der Körperfettanteil im Verhältnis zur Magermasse (Knochen, Bänder, Sehnen, Muskeln, Organe).
Man muss nicht einmal übergewichtig sein, um zu viel Körperfett zu haben.
Auch schlanke Menschen können zu viel Fettgewebe mit sich herum tragen.
Solche schlanken Menschen haben verhältnismäßig viel Fettmasse im Vergleich zur fettfreien Masse. Man nennt sie „skinny fat“. Laut BMI werden sie als normalgewichtig eingestuft, doch metabolisch gesehen sind sie adipös. Damit teilen sie die entsprechenden Krankheitsrisiken mit übergewichtigen Menschen.
Körperfett reduzieren zu wollen, ist also nicht nur eine Frage des ästhetischen Empfindens, sondern der Gesundheit.
Der Unterschied zwischen „normal“ und „optimal“
Im 21. Jahrhundert sind wir im Alltag den Anblick von leichtem Übergewicht und entsprechenden Körperfettanteilen so gewöhnt, dass es das neue „normal“ ist.
Statistisch betrachtet ist die Gewichtsverteilung in Deutschland mittlerweile gedrittelt[2]:
- etwas über ein Drittel der deutschen Bevölkerung sind normalgewichtig
- etwas mehr als ein Drittel ist leicht übergewichtig
- etwas weniger als ein Drittel ist adipös
- nur etwa ein Prozent ist der Menschen in Deutschland ist heutzutage untergewichtig
Die „Mitte“ unserer Gesellschaft – also das, was quasi die Norm darstellt – ist leichtes Übergewicht.
Das bedeutet, unser heutiges „normal“ ist nicht unbedingt optimal (für unsere Gesundheit).
Wie viel ist zu viel, zu wenig und genug?
Medizinische Empfehlungen und Normwerte bezüglich des Körperfettanteils hängen von Alter, Geschlecht und Körperbau ab.
Im Internet sind abweichende, teils widersprüchliche Informationen über Köperfettverteilungen zu finden und auch darüber, wie bestimmte Körperfettwerte optisch aussehen (Bildervergleich). Das liegt daran, dass es unterschiedliche Messmethoden gibt und je nach Methode der Gesamtkörperfettanteil ermittelt wird oder nur das subkutane Unterhautfett.
Hier findest Du einen tabellarischen Überblick mit Richtwerten für Männer und Frauen als Orientierung.
| Unterteilung | Anteil für Männer (in %) | Anteil für Frauen (in %) |
| essentielles Körperfett | 2-5 | 8-10 |
| athletisch | 6-13 | 13-19 |
| fit | 14-17 | 20-24 |
| unsportlich | 18-24 | 25-31 |
| übergewichtig | 25+ | 32+ |
Wissenschaftler sehen den idealen Körperfettanteil für Männer zwischen 12% und 20% und für Frauen zwischen 20% und 30% [3].
Es gibt Menschen mit einem Körperfettanteil unterhalb der Norm-Werte, die sich dennoch bester Gesundheit befinden, wie z.B. Profi-Athleten.
Ist es okay, im „Norm“-Bereich zu sein?
Das Idealgewicht ist ein schwieriges Thema. Denn heutzutage wird leichtes Übergewicht trotz Bekanntheit der Krankheitsrisiken gerne verharmlost und „Body Shaming“ schnell dafür verwendet, Abnehm-Bestrebungen zu verurteilen.
Body Shaming, also die Diskriminierung bzw. Beleidigung von Menschen aufgrund ihres Körpers, ist natürlich grundsätzlich ein No-Go.
Ob man sich im Norm-Bereich wohl fühlt, ist eine Frage, die individuell beantwortet werden muss. Jede*r sollte in dem Körper leben, in dem er*sie sich wohl fühlt. Doch Toleranz gilt in beide Richtungen. Deshalb muss auch jede*r, der*die gern etwas verändern möchte, die Möglichkeit bekommen, außerhalb des „Normbereichs“ liegen zu wollen.
Dennoch möchte ich hier auf die Tendenz in unserer Gesellschaft hinweisen, dass gesund und „leicht“ immer weiter zu einer Randerscheinungen wird.
War Marilyn Monroe übergewichtig?
Marilyn Monroe trug zu ihren Lebzeiten Größe 42. Wenn die durchschnittliche Frau heute Größe 42 trägt, trägt sie die Größe „50er Jahre Sexsymbol“. Klingt doch ganz angenehm, oder?
Leider hat Kleidergröße 42 aus den 50er Jahren nichts mehr mit Kleidergröße 42 im Jahr 2021 zu tun.
Marilyn war – laut Angaben ihres Ausweises und ihres Kleidermachers – etwa 166cm groß, wog 53,5kg und hatte damit einen BMI von 19,5. Das entspricht dem BMI heutiger Hollywood-Stars, aber nicht dem BMI des heutigen Durchschnittsbürgers. Mit einem BMI von 19,5 wäre Marilyn Monroe also auch nach heutigen Maßstäben extrem schlank [4].
Wie passt das zusammen?
Kleidungshersteller haben ihre Konfektionsgrößen der körperlichen Entwicklung der Gesellschaft angepasst. Konfektionsgröße 42 aus den 50er Jahren hat nicht die gleichen Maße wie Konfektionsgröße 42 heute.
Die Entwicklung von schlank als „normal“ bis leicht übergewichtig als neues „normal“ war schleichend. Sie fiel uns vor allem deshalb kaum auf, weil es von Modeherstellern unterstützt wurde. Und zwar mit einem Trick namens „Vanity Sizing“.
„Vanity Sizing“ beschreibt die allmähliche Anpassung der Kleidergrößen an die Norm der Gesellschaft durch die Hersteller. Das bedeutet, dass die Abmessungen der Kleidergrößen, wie wir sie kennen, sich verändert haben, während die Bezeichnung oder Größenangabe gleich geblieben sind. Modehersteller haben ein verständliches Motiv: mit unzufriedenen Kunden macht man kein gutes Geschäft. Doch ein*e geschmeichelte*r Kunde*in ist ein*e kauffreudige*r Kunde*in [5].
Die Hersteller denken ökonomisch, aber die Kunden werden getäuscht.
Kleidergrößen sind also generell ein schlechter Maßstab für eine „gesunde“ Figur, denn sie passen sich der gesellschaftlichen Entwicklung an.
Key Take Aways
Der Körperfettanteil hat einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit. Körperfettabbau ist also nicht nur eine Frage des ästhetischen Empfindens, sondern eine Frage der Gesundheit.
Statistisch betrachtet ist leichtes Übergewicht durch zu viel Depotfett das neue „Normal“ unserer Gesellschaft. Auch schlanke Personen können einen zu hohen Körperfettanteil aufweisen. Das bedeutet, dass es aus gesundheitlichen Aspekten nicht unbedingt erstrebenswert ist, im „Normbereich“ zu liegen. Die Norm ist nicht gleichzusetzen mit dem gesundheitlichen Optimum und auch nicht mit dem individuellen Ideal.
Welches gesundheitliche Risiko durch Körperfett jede*r Einzelne für sich akzeptiert und bei welchem Körperfettanteil er*sie sich wohl fühlt, ist eine persönliche Entscheidung und kann nicht in Statistik erfasst werden.
Quellen
[1] Prof. Dr. med. Beliveau, R. und Dr. med. Gingras, D. (2017)2: Krebszellen mögen keine Himbeeren, S. 46 f. München.
Reaven GM., „Insulin resistance: the link between obesity and cardiovascular disease.“ Med Clin North Am. 09.2011;95(5):875-92 .
Pesheva, E. (2014) Study: Obesity fuels silent heart damage, increased risk of future heart failure. Evidence of heart muscle damage seen even among symptom-free people. John Hopkins News Network: November 25, http://hub.jhu.edu/2014/11/25/obesity-heart-disease-risk.
[2] Mensik et.al. (2013): Übergewicht und Adipositas in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt 56, 786-794.
[3] Abernathy et.al., Purdue University, 1996. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8615340 (Stand 06-2018).
[4] Dr. Hermann, N. (2017)13: Fettlogik überwinden, S. 312. Berlin
[5] Dr. Hermann, N. (2017)13: Fettlogik überwinden, S. 97f. Berlin